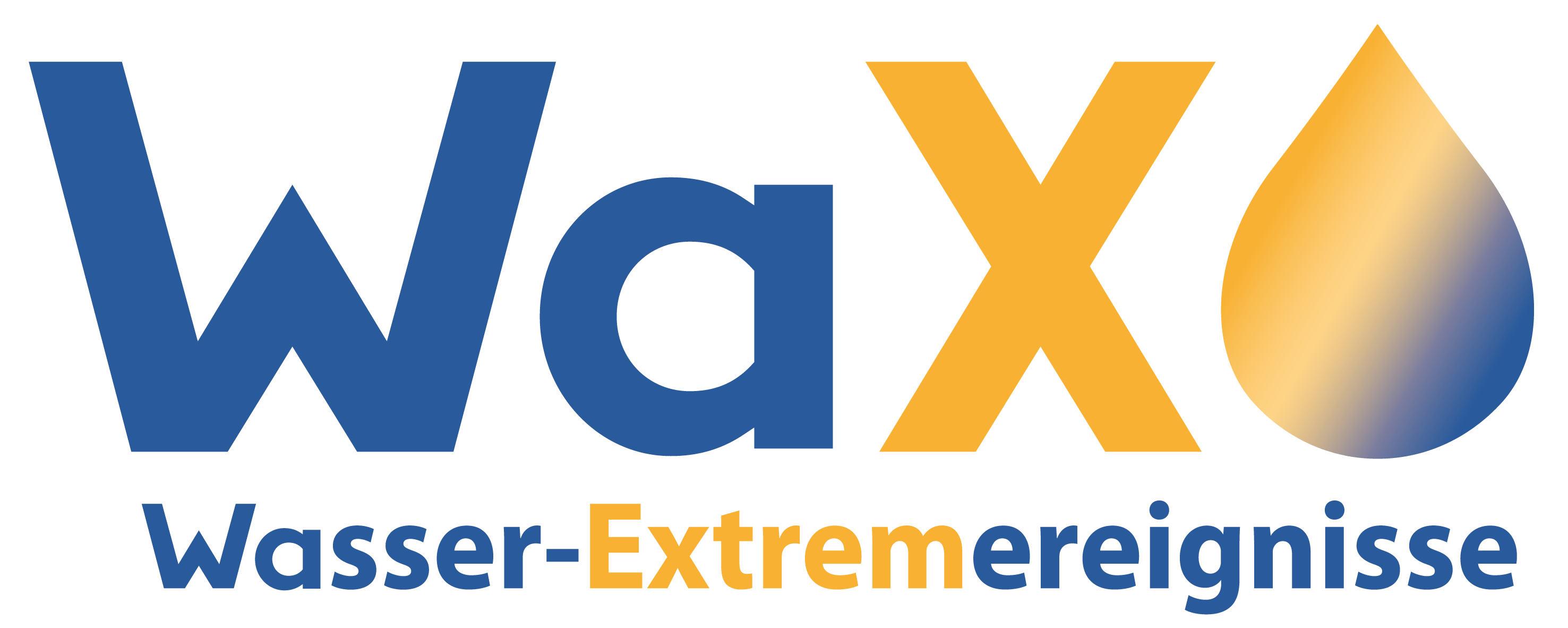Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts haben sich die Potsdamer Afrikagespräche als zentrales Forum für die Förderung regionaler Zusammenarbeit etabliert. Organisiert von der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:) bringt die Veranstaltung Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft, politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft aus Afrika und Europa zusammen, um drängende regionale Herausforderungen zu erörtern. Die Ausgabe 2025 widmete sich dem Thema Wasserdiplomatie in Afrika und thematisierte die zunehmenden wasserbezogenen Herausforderungen auf dem Kontinent, die immer stärker Lebensgrundlagen, Ökosysteme und regionale Stabilität bedrohen. Angesichts des wachsenden Drucks auf die Regierungen und begrenzter Wirksamkeit ihrer bisherigen Maßnahmen ging die Konferenz der Frage nach, wie internationale Zusammenarbeit, regionale Mechanismen und lokale Initiativen besser aufeinander abgestimmt werden können, um nachhaltige Strategien im Wassermanagement zu entwickeln, die Frieden und Entwicklung in Afrika fördern.
In ihrer Keynote sprach Dr. Jenniver Sehring (IHE Delft) über die doppelte Rolle des Wassers als mögliche Konfliktursache und zugleich als Triebkraft für Frieden. Während in der öffentlichen Debatte häufig das Bild von „Wasserkriegen“ um grenzüberschreitende Wasserressourcen bemüht wird, zeigt die Realität ein differenzierteres Bild: In der Praxis ist Zusammenarbeit über gemeinsame Wasserressourcen deutlich häufiger als Konflikt. Solche Kooperationen bieten vielfältige Vorteile – sie verhindern nicht nur Auseinandersetzungen, sondern fördern auch die sozioökonomische Entwicklung, tragen durch koordinierte Maßnahmen zum Schutz von Flüssen zur ökologischen Nachhaltigkeit bei und stärken die politische Stabilität.
Sehring betonte, dass die Zusammenarbeit im Bereich Wasser über den reinen Sektor hinauswirken kann. Sie kann Vertrauen zwischen Staaten und Akteuren aufbauen und so breitere Kooperationen ermöglichen. Konflikt und Kooperation schließen sich dabei nicht aus – sie können parallel bestehen. Wasserdiplomatie versteht Sehring als einen kontinuierlichen Aushandlungsprozess darüber, wie Zusammenarbeit gestaltet wird. Dabei ist Wasserdiplomatie nicht auf klassische diplomatische Kanäle beschränkt. Auch Nichtregierungsorganisationen, Fachleute und lokale Gemeinschaften spielen eine zentrale Rolle – insbesondere im Rahmen von basisnaher, „people-to-people“-Diplomatie.
Eine besondere Herausforderung sieht Sehring in den Machtasymmetrien, die häufig die Governance grenzüberschreitender Gewässer prägen. Daher sei es entscheidend zu fragen, wer tatsächlich von Kooperation im Wassersektor profitiert und welche Stimmen bislang fehlen. Eine inklusivere Wasserdiplomatie erfordert es, marginalisierte Perspektiven gezielt zu stärken und eine gleichberechtigte Beteiligung vielfältiger Akteure sicherzustellen.
Die zweite Keynote am zweiten Konferenztag hielt Julienne Ndjiki von der Global Water Partnership Southern Africa. Sie beleuchtete die geschlechtsspezifischen Dimensionen von Wasserknappheit und Governance. In vielen ländlichen und peri-urbanen Gebieten Afrikas tragen Frauen und Mädchen die Hauptverantwortung für das Holen, Nutzen und Verwalten von Wasser für Trinken, Kochen, Hygiene und Landwirtschaft. Trotz ihres umfassenden Wissens auf Gemeindeebene werden ihre Beiträge in formalen Governance-Strukturen häufig nicht anerkannt.
Ndjiki hob hervor, dass Frauen häufig kreative, gemeinschaftsbasierte Lösungen für Wasserknappheit entwickeln – darunter Regenwassernutzungssysteme, effiziente Bewässerungsmethoden oder informelle Mechanismen zur gemeinsamen Wassernutzung. Diese innovationsgetriebenen Ansätze bergen großes Potenzial zur Skalierung. Frauen übernehmen darüber hinaus Funktionen als Gesundheitsvermittlerinnen und Multiplikatorinnen, die Hygienemaßnahmen, Wassersicherheit und Ressourcenschonung in ihren Gemeinden fördern. Ihre sozialen Netzwerke können in Krisenzeiten entscheidend zur Mobilisierung kollektiver Maßnahmen beitragen.
Trotzdem stehen Frauen im Wassersektor vor erheblichen Herausforderungen. Da sie häufig für die Wasserbeschaffung verantwortlich sind, sind sie von Wasserunsicherheit besonders stark betroffen. Lange Wege zur Wasserquelle beeinträchtigen ihre Gesundheit und schränken Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten ein. Geschlechterstereotype und soziale Normen beschränken zusätzlich den Zugang zu Informationen, Entscheidungsprozessen und Führungsrollen. Institutionelle Fördermaßnahmen wie Mentoring oder berufliche Weiterentwicklung sind oft unzureichend.
Ndjiki stellte das Programm AIP-WACDEP-G (Water, Climate, Development and Gender Investments) vor – eine Schlüsselinitiative im Rahmen des Continental Africa Water Investment Program, das in fünf afrikanischen Ländern pilotiert wurde. Ziel des Programms ist es, institutionelle Kapazitäten aufzubauen, um sicherzustellen, dass Investitionen in wasserbezogene Infrastruktur, Governance-Strukturen und beschäftigungsfördernde Maßnahmen strategisch zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen. Sie unterstrich die Bedeutung der Einbindung von Frauen in Wassergovernance und Friedensprozesse – insbesondere wegen ihres Wissens über lokale Wasserquellen und der Bedürfnisse ihrer Gemeinden sowie ihrer Fähigkeit, interkommunale Beziehungen langfristig zu pflegen oder neu zu etablieren.
In den Panels der Konferenz wurden vielfältige Fallstudien zur Wasserdiplomatie auf unterschiedlichen Governance-Ebenen vorgestellt:
Das erste Panel mit dem Titel „Gemeinsame Wasserressourcen managen: Die Rolle regionaler Zusammenarbeit in der Wasserdiplomatie“ untersuchte, wie afrikanische Institutionen und Flussbeckenorganisationen zur Lösung von Wasserstreitigkeiten und zum gerechten Zugang zu Wasser beitragen. Vertreterinnen und Vertreter der Nile Basin Initiative und der Niger Basin Authority berichteten über spezifische Herausforderungen und Chancen in ihren Einzugsgebieten.
Das zweite Panel, „Brücken bauen: Entwicklungszusammenarbeit in der Wasser-Governance“, brachte Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der Weltbank und der Kommission der Afrikanischen Union zusammen, um über die Rolle internationaler Akteure in der Unterstützung afrikanischer Wassergovernance zu diskutieren.
Das dritte Panel, „Blue Africa: Transnationale Wasserkooperation durch Afrika-Europa-Partnerschaften voranbringen“, widmete sich der Initiative „Blue Africa“ im Rahmen der Team Europe Initiative zur grenzüberschreitenden Wasserbewirtschaftung in Afrika (TEI TWM). In Zusammenarbeit mit dem African Ministers’ Council on Water (AMCOW) und der Kommission der Afrikanischen Union (AUC) zielt die Initiative darauf ab, institutionelle Rahmenbedingungen zu stärken, nachhaltige Entwicklung zu fördern und die Klimawiderstandsfähigkeit durch verbesserte grenzüberschreitende Wasserbewirtschaftung zu erhöhen.
Das vierte Panel mit dem Titel „Widerstandskraft von Gemeinschaften stärken: Lokale Lösungen für Wasserkonflikte“ zeigte auf, wie wirkungsvoll gemeindebasierte Ansätze zur Lösung von Wasserkonflikten beitragen können. Ein herausragendes Beispiel war die Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation (LVRLAC), die verdeutlichte, wie lokale Partnerschaften effektive Wasser-Governance und Konfliktlösung auf kommunaler Ebene ermöglichen.
Zum Abschluss der Konferenz fassten mehrere Panelistinnen und Panelisten zentrale Erkenntnisse zusammen:
- Das Umfeld für Wasserdiplomatie ist dynamisch und erfordert anpassungsfähige sowie reaktionsschnelle Strategien.
- Zielgerichtete Investitionen – insbesondere dort, wo sie den größten Einfluss haben – sind essenziell. Der Aufbau lokaler Resilienz und die Entwicklung nationaler Finanzierungsmechanismen sind Schlüsselkomponenten nachhaltiger Wassergovernance.
- Geschlechterperspektiven müssen systematisch in die Wasserdiplomatie integriert werden. Ein tiefgreifender Wandel von Normen und Einstellungen ist notwendig, um echte Teilhabe zu ermöglichen.
- Wie ein Panelist formulierte: „Das Wasser selbst ist nicht das Problem – das Problem ist unsere Unfähigkeit, Einigkeit über das zu erzielen, was wir teilen müssen.“ Dies unterstreicht die Notwendigkeit für stärkeren Dialog und Vertrauensbildung.
- Wasserdiplomatie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Akteure – von Regierungen bis zu lokalen Gemeinschaften – einbinden sollte. Die zentrale Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, diese Vielfalt sinnvoll zusammenzuführen.
- Wasser kann ein starker Motor für Kooperation, wirtschaftliche Entwicklung, sozialen Wandel und Inklusion sein.
Die Konferenz brachte zahlreiche innovative Ideen, praxisorientierte Ansätze und neue Kooperationsmöglichkeiten hervor, die als Grundlage für eine zukunftsorientierte Wasserkooperation in Afrika und darüber hinaus dienen können.
Hier finden Sie den gesamten Bericht auf Englisch zum Download.
Dr. K. Lebek